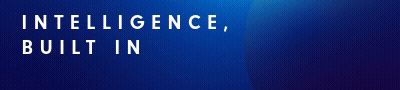KI birgt Potenzial für Handelsunternehmen, besonders in den Bereichen Einkauf, Eigenmarkenmanagement und Sortimentssteuerung. Der Gründer der eCommerce-Beratung Encurio, Sebastian Rahmel, erläutert, welche Schritte Effizienz- und Umsatzsteigerungen erzielen können.

Nach Angaben des aktuellen HDE-Online-Monitors planen etwa 50 Prozent der Handelsunternehmen in Deutschland den Einsatz von KI in den Bereichen Category-Management, Einkauf und Eigenmarke. Die tatsächliche Nutzung beträgt aktuell allerdings nur 27 Prozent. Dabei belegt die Praxis, dass KI-gestützte Systeme herkömmlichen Methoden wie der ABC-Analyse klar überlegen sind.
Mehrerlöse durch den Einsatz von KI
Jüngst begleitete ich ein Unternehmen bei der Implementierung KI-getriebener Sortimentsoptimierung und prädiktiver Analysen. Durch die KI-gestützte Pricing-Automatisierung erzielte die Firma achtstellige Mehrerlöse und steigerte ihre Marktplatzumsätze um bis zu 25 Prozent. Intelligente Preissteuerung unterstützt Unternehmen darin, das Umsatzpotenzial ihrer Top-Produkte (20 Prozent) auszuschöpfen und hebt auch das Potenzial der oftmals vernachlässigten 80 Prozent. Überbestände wurden ab- und Bestände des Kernsortiments bewusst aufgebaut. KI-gestützte Prognosen und Auswertungen befähigten dahingehend, Strategien tagesaktuell zu justieren und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Der Weg zum Erfolg verlief jedoch alles andere als geradlinig: Skepsis auf Unternehmensseite, technische Hürden, Fehlschläge durch falsche Ansätze und die Herausforderung, mit Halluzinationen umzugehen, machten mehrere Anläufe notwendig, begleitet von intensiver Datenaufbereitung und umfassenden Schulungen der Mitarbeitenden.
Vom Kundenfeedback zur Wertschöpfung
KI-basierte Kundenfeedbackanalysen, Rezensionen und Echtzeitmarktdaten sind heute die zentralen Hebel, um Sortimentslücken zu identifizieren und Produktdesigns entlang der Verbraucherbedürfnisse zu verbessern. Die bereits erwähnte Firma setzte spezialisierte Softwarelösungen ein, die alle verfügbaren Online-Reviews und Social-Media-Daten automatisiert untersuchte und clusterte. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Produktentwicklung, die Servicegestaltung und das Qualitätsmanagement ein.
Zufriedene Kunden um eine Bewertung zu bitten, kann eine kurzfristige Maßnahme sein, um Online-Rezensionen aufzuwerten. Monetäre Effekte wie Umsatz- und Margensteigerung stellen sich frühestens nach mehreren Monaten ein. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung und Markenaufbau sorgen hier allerdings für einen langfristig gesunden Umsatz- und Gewinnzuwachs.
Mit Eigenmarken zum wirtschaftlichen Erfolg
Im Einkauf und der Eigenmarkensteuerung bewirkt der KI-Einsatz höhere Abverkaufsquoten, präzisere Einkaufsprognosen und eine systematische Sortimentssteuerung. Eigenmarken profitieren besonders von der beschleunigten Identifikation einträglicher Nischen und der datengetriebenen Produktentwicklung. Einem Double Check bedürfen KI-Entscheidungen jedoch unbedingt: Erste Ergebnisse bergen oftmals Fehler oder spiegeln Halluzinationen wider, sofern die Datenbasis nicht stimmt. Unternehmen müssen die Systeme in diesem Fall bis zu ihrer nachweislichen Belastbarkeit anpassen. Human-in-the-Loop-Prinzipien und Explainable-AI-Ansätze sind essenziell, um Fehlsteuerungen und Vertrauensverluste zu vermeiden.
Neben der Sortimentsauswahl und Preissteuerung lassen sich auch Cross- und Upselling-Maßnahmen skalieren. Einmal eingerichtet, laufen viele der genannten Prozesse autonom und erlauben es, Ressourcen auf wertschöpfende Aufgaben zu lenken. Das beschriebene Unternehmen sparte darüber bis zu 30 Prozent Personalstunden ein, während die Verfügbarkeit der Top-Produkte stieg und das Unternehmen bei B- und C-Produkten exorbitante Umsatzsprünge erwirtschaftete.
Mitarbeitende bereit machen
Technische Hürden wie Datenqualität oder Systemintegration sind nicht immer das Hauptproblem in puncto KI-Integration. In vielen Fällen reichen schon vorhandene Datenformate aus, um KI-Pilotprojekte wirksam anzustoßen. Vielmehr gilt es, vom Wandel Betroffene von Beginn an einzubinden und transparent zu vermitteln, was KI leisten soll und welche Rolle die Mitarbeitenden in diesem Mensch-KI-Konstrukt übernehmen. Zu den typischen Fehlern auf Organisationsseite zählen mangelnde Kommunikation, fehlende Integration der verschiedenen Interessensgruppen und unzureichende Unterstützung für die Teams. Frühzeitige und fortwährende Information der Belegschaft, partizipative Projektgestaltung, niedrigschwellige Einstiegsszenarien sowie Qualifizierung der Mitarbeitenden im Umgang mit KI gehören zu den ausschlaggebenden Erfolgsparametern. Wichtiger als Perfektion ist der erste Schritt. Fehler zählen zum Prozess und der strategische Gewinn gleicht Startschwierigkeiten aus.
Fazit
Erfolgsweisend ist nicht die Technologie allein, sondern der Mensch im Mittelpunkt. Unternehmen, die Change-Management, Stakeholder-Integration und Human-in-the-Loop ernst nehmen, generieren per KI-Einsatz schon in kurzer Zeit signifikante Mehrwerte in puncto Umsatz, Prozesseffizienz und Kundenbindung. KI-Implementierung heißt, aktiv zu steuern, welche Entscheidungen delegiert gehören und welche in menschlicher Hand bleiben. Viele Projekte scheitern an überzogener Eile, mangelnder Konsequenz oder fehlendem Durchhaltevermögen. Die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Tech-Innovation und gelebte Zusammenarbeit ineinandergreifen.